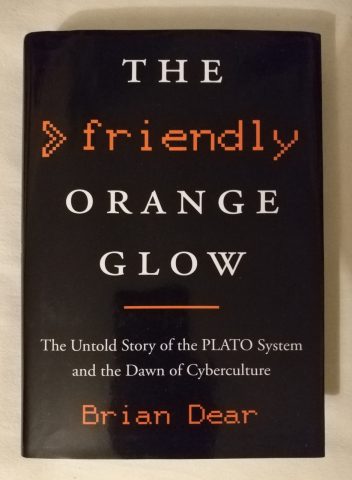Ich habe mich selbst so lange ich politisch denke – also ungefähr seit ich 10 Jahre alt war – immer gemäßigt links eingeordnet. Der stumpfe reaktionäre Mainstream der 70er Jahre war mir unerträglich und verhasst. Dieses bigotte Auftreten der alten Leute, die die Moralkeule vor sich hertrugen war und ist mir immer noch zutiefst zuwider.
Der Mainstream hat sich seitdem ganz gewaltig nach links verschoben. Müsste mir also doch eigentlich gut gefallen. Tut es aber nicht. Ich habe mit “Links” mittlerweile genau so ein Problem wie mit “Rechts” (falls diese Einteilung heute überhaupt noch Sinn macht).
Klar, man sagt ja, dass man mit zunehmendem Alter konservativer wird. Ein bisschen ist da was dran. Aber darum geht es mir gar nicht. Die großen Themen, die von den jungen Leuten angesprochen werden sehe ich als genauso wichtig an: Umweltschutz, Gleichberechtigung, Widerstand gegen Rechtsextremismus, usw.
Das sind ja alles Themen, die mir auch in meiner Jugend schon wichtig waren. Damit habe ich überhaupt kein Problem.
Womit ich aber ein ganz erhebliches Problem habe, ist die Art der (nicht-)Kommunikation. Diese häufige moralinsaure Besserwisserei, die ich damals von den alten Säcken kannte und die nun ausgerechnet ihre Enkel wiederaufleben lassen. Dieses bei jedem Thema meilenweit über das Ziel hinausschießen. Mein Problem dabei ist, dass man Leute vergrätzt und vor den Kopf stößt, die eigentlich in die selbe Richtung denken und völlig unnötig Gräben aufreißt.
Klar, wenn man ein Anliegen hat, muss man laut trommeln. Und wenn man die Bräsigkeit vieler älterer Leute sieht, die einfach überhaupt nichts ändern wollen – das kann einen schon zur Weißglut bringen. Ich möchte trotzdem mal drei Beispiele bringen, was ich mit “meilenweit über das Ziel” meine:
Gleichberechtigung?
Neulich gab es einen Artikel (Zeit, Spiegel, Tagesspiegel – ich weiß nicht mehr wo) in dem Stand, dass es viele Männer nicht ertragen, wenn ihre Frauen gleich viel oder mehr verdienen.
Ja, o.k, kann sein. Gibt es bestimmt. Da möchte ich nicht widersprechen.
Was aber nicht einmal als Andeutung vorkam war die Frage, wie viele Frauen es nicht ertragen, wenn ihr Mann dauerhaft weniger verdient als sie selbst. Das ist nämlich ebenfalls ein erhebliches Problem, wie ich aus meiner eigenen Umgebung weiß. Und das trifft insbesondere auf BesserverdienerInnen zu, bei denen es eigentlich nicht so drauf ankommt. Die Richterin, die es nicht erträgt, dass ihr Mann “bloß” Teamleiter einer IT Abteilung ist, die Chefärztin, der es auf Dauer nicht reicht, dass ihr Kerl “nur” normaler Rechtsanwalt ist. Eigentlich war Geld kein Problem, und trotzdem hatten diese Frauen das Gefühl dass sie “einen Verlierer mit durchfüttern”. Eigentlich sind alle Frauen, die ich kenne, die sehr viel Wert auf ihre Karriere legen, letzten Endes auf eigenen Wunsch Single.
Warum lese ich von so etwas nicht einmal einen Halbsatz?
Verkehrswende
Die Verkehrswende ist absolut überfällig. Das sage ich als Besitzer von zwei benzingetriebenen Fahrzeugen, ehemaligem Vielflieger und jahrelangem Fernpendler. Ich habe die Hypermobilität in den letzten Jahren für mich selbst einigermaßen erfolgreich eindämmen können. Zudem verstehe ich als ehemaliger Stadtplaner auch ein bisschen was von der Materie.
Wir Planer wussten auch schon vor 30 Jahren, was man hätte tun müssen – aber es wurde weniger als nichts getan. Es wurde sogar alles noch schlimmer gemacht: Nebenstecken abgebaut, Shoppingcenter, Möbelhäuser und Baumärkte an die Autobahn gesetzt, Wohngebiete ohne ÖPNV Anschluss gebaut, Flexibilisierung der Arbeit, Dumpingpreise für Flugreisen…
Das muss aufhören. Schnell. Das Problem ist, dass jetzt nur darüber geredet wird, die Städte für Autos zu schließen. Das geht m.E. völlig am Problem vorbei und könnte am Ende sogar kontraproduktiv sein. Es geht nicht nur um Autos, sondern um den stetig steigenden Verkehr als ganzes. Ich schreibe dazu demnächst noch einen eigenen Artikel.
Der Verkehr ist nur das Symptom für andere Sachzwänge. Nur ein Detail: Wie wäre es z.B. damit dem Jobcenter klar zu machen, dass tägliches Pendeln über 100km pro Strecke eben nicht zumutbar ist, sondern einfach nur asozial. Wie wäre es, mit einer Stadtplanung, die von vornherein lange Wege vermeidet? Wie wäre es mit aktiver Wohnungs- und Standortpolitik?
Antifaschismus
Heute habe ich das erste mal jemanden aus meiner Facebook Kontaktliste gekickt. Ein Kontakt (Bereich Musik), den ich schon länger hatte, aber nie wirklich persönlich kennengelernt habe. Was war passiert?
Es gibt in Berlin einen Club mit dem etwas bräsigen Namen “Beate Uwe”. Diese Person stellte den Club plötzlich unter Faschismusverdacht, weil zwei NSU Terroristen diese Vornamen haben.
Ähm, ja, wie vermutlich noch eine Millionen anderer Deutscher.
Nun ist mein Ex-FB Kontakt nicht aus Deutschland. Daher nahm ich an, dass sie das Wortspiel mit “Beate Uhse” nicht verstanden hat. Das ist halt so ein kulturelles Ding, das man vermutlich nur versteht, wenn man hier ausgewachsen ist. Also nahm mir die Freiheit, sie freundlich(!) darauf hinzuweisen, dass man als Deutscher vermutlich eher diese Assoziation, anstatt an Terroristen zu denken. Die Reaktion darauf war sinngemäß:
“Das mit den Terroristen sei doch offensichtlich. Sie sei nicht an irgend so einem deutschen Pornostar(!!!) interessiert. Ob ich mit einbilde, für alle Deutschen zu sprechen – and by the way who do you think you are, Daddy?”
WTF???
Auf meine immer noch höfliche Nachfrage, weshalb sie so aggressiv reagiere, hat sie nicht geantwortet. Dafür haben andere Leute geschrieben, dass das ein sehr entspannter Multi-Kulti-Club ist. Sie wurde wohl auch von dem Club direkt angeschrieben. Etwas pikant ist, dass sie selber DJ ist.
Man kann ja mal etwas falsch verstehen. Passiert. Aber dann sollte man wenigstens den Arsch in der Hose haben zu sagen “Sorry, ich habe da wohl etwas überreagiert” anstatt andere Leute aggressiv anzupampen.
Berlin besteht gefühlt zu 50% aus solchen Soziopathen. Ich habe auf solche Leute einfach keinen Bock mehr.
Für einen medialen Aufreger der letzten Woche hat Dieter Bohlen gesorgt (OMG, dass dieser Name jemals in meinem Blog auftauchen würde, hätte ich nie gedacht).
Was war passiert?
In irgendeiner dieser dümmlichen Fernsehshows hat Bohlen ein fünfjähriges Mädchen gefragt, wo es denn herkommt. Das Mädchen hat geantwortet “aus Herne”. Das hat ihm aber als Antwort nicht ausgereicht, da das Mädchen offensichtlich nicht “biodeutsch” aussah. Er hat immer weiter nachgebohrt und das Mädchen hat gar nicht verstanden, was der Mann von ihr eigentlich wollte.
Interessant daran finde ich, dass hier zwei Menschen völlig aneinander vorbei geredet haben. Das Mädchen hatte natürlich vollkommen korrekt geantwortet – es kam aus Herne. Was beide aus sehr unterschiedlichen Gründen nicht verstanden haben, ist dass er eigentlich etwas anderes wissen wollte, als er gefragt hat, nämlich “welche ethnische Herkunft hat Deine Familie”. Bohlen scheint diese Abstammungsfrage sehr wichtig zu sein und er hat nicht verstanden, dass er die falsche Frage gestellt hat. Dem Mädchen ist ihre ethnische Abstammung völlig egal – möglicherweise hätte sie die Frage nicht mal beantworten können, wenn Bohlen sie korrekt gestellt hätte und sie kannte dieses “um die Ecke fragen” noch nicht.
Das peinliche daran ist, dass Bohlen einfach nicht die Kurve gekriegt hat. Andrerseits – Bohlen ist von Anbeginn seiner Karriere für mich der Inbegriff des Peinlichen. Also was soll’s?
Was geht mich Dieter Bohlen an?
Blöd an sowas ist aber, dass man auch im echten Leben leicht falsch verstanden werden kann, wenn man wirklich wissen will, woher jemand kommt. Mir ist neulich das Folgende passiert:
Ich war auf einer Geburtstagsfeier eingeladen. Die Anwesenden waren zu 2/3 “biodeutsch”. Ein vielleicht nicht ganz unwichtiges Detail ist, dass es sich durchweg um gut ausgebildete und in der Welt herumgekommene Menschen handelte. Das wurde spätestens nach der Debatte um die Stadt, in der man am liebsten arbeiten würde klar. Denn hier ging es nicht um Berlin, Hamburg oder München, sondern um Berlin, Zürich, London, Rom, San Francisco oder Tokyo.
In dieser Umgebung kam ich mit einer charmanten jungen Dame ins Gespräch. Sie sah asiatisch aus, aber ihr astreines, fehlerfreies Deutsch und das ganze Verhalten machte eindeutig klar, dass sie in Deutschland aufgewachsen war. Irgendwann griffen wir noch einmal die Städtefrage auf. Ich habe gesagt, dass ich in Hannover aufgewachsen bin und mir mit Berlin am Anfang sehr schwer getan habe. Sie meinte, über Berlin kann sie noch nicht so viel sagen. Sie komme nicht von hier, sondern sei erst seit ein paar Monaten in der Stadt.
Und dann habe ich einfach gefragt: “Und wo kommst Du her?”
Das hatte ich kaum ausgesprochen und dachte mir “Ach Du Scheisse – hoffentlich versteht sie das jetzt nicht falsch”. Diese Frage zielte nämlich NICHT auf ihre ethnische Abstammung. Das hätte ich in der Situation einfach jeden gefragt.
Zu meiner Erleichterung hat sie einfach geantwortet “Aus Bielefeld”.
Ich dachte dann nur “Danke, Du hast mich genau richtig verstanden”. Auf die üblichen flachen Bielefeld-Witze habe ich selbstverständlich verzichtet.
Zum Abschluss des ersten warmen und schönen Wochenende des Jahres möchte ich ein (für mich) bemerkenswertes Jubiläum verkünden:
Dies ist der 1000. Artikel in meinem Blog.
(Wie Kermit sagen würde: “Applaus, Applaus, Applaus!”)
Als ich mit dem Bloggen angefangen hatte, dachte ich, dass ich das drei oder vier Monate lang machen würde. Mein Plan war, begleitend zu meiner Diplomarbeit immer mal wieder den aktuellen Zwischenstand öffentlich zu verkünden (siehe meinen ersten Eintrag “Jetzt geht’s loooos… vom 16. Juli 2006″. Der Subtitel des Blogs ist “tiny little gizmos”, weil mein Diplomthema seinerzeit “Mobile Virtual Communities” waren. Ich vermutete, mich daher viel mit mobilen Endgeräten auseinandersetzen zu müssen. Das war noch vor der Einführung des ersten iPhone und Facebook war in Europa noch kein Thema.
Mein Plan ging nicht auf.
In die Diplomarbeit habe ich soviel Zeit und Energie investiert, dass kaum etwas davon für den Blog übrigblieb. Andererseits habe ich anschließend Gefallen daran gefunden, mich immer mal wieder über das eine oder andere Thema, das mich gerade beschäftigte, zu schreiben.
Für eine Weile wird das sicher auch noch so bleiben.
Vor ein paar Wochen bin ich 50 geworden und habe ein Buch geschenkt bekommen: “The friendly orange glow” von Brian Dear mit dem Untertitel “The untold story of the PLATO System and the dawn of cyberculture”. Es thematisiert PLATO – ein Computersystem von früher. Nach Maßstäben der Computerhistorie sogar von noch früher. Quasi von der digitalen Frühantike.
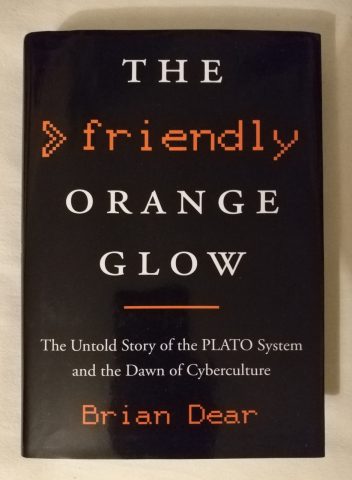
The friendly orange glow
Was hatte es mit dem PLATO System auf sich?
Dazu kurz ein Rückblick auf meine Jugend.
Für mich fing die Digitalisierung der Gesellschaft ungefähr 1980 an. Damals hatte in der Bevölkerung fast niemand etwas mit Computern zu tun gehabt und plötzlich gab es überall Homecomputer und kurze Zeit später Personal Computer zu kaufen. Ich habe mich Hals über Kopf in das Thema gestürzt, bin um 1990 das erste Mal Online gegangen und habe noch vor dem Internet in den Mailboxen (oder BBS) Foren, Chats, E-Mail und Online Spiele kennengelernt. Damit habe ich mich lange zu den Online Pionieren gezählt.
Damit lag ich allerdings ganz schön falsch!
Zunächst fand ich heraus, dass das erste BBS bereits 1978 von Ward Christensen entwickelt und in Betrieb genommen wurde. Etwas später habe ich gelernt, dass das Internet nicht etwas mit dem World Wide Web 1991 begann, sondern seine Wurzeln bis in die 1960er Jahre zurückreichen und dass der erste Computer mit grafischer Benutzeroberfläche nicht etwas die Apple Lisa von 1983 war, sondern der XEROX Alto von 1973.
Und dann bin ich über ein Bild von gestolpert, auf dem ein Terminal mit orangefarbenem Gas-Plasma Touch Display zu sehen war, auf dem eine einfache Art 3D Shooter zu sehen war. Und darunter stand “PLATO IV Terminal (ca. 1975)”.
Wie bitte? 1975?
Zu dem Zeitpunkt liefen viele Computer noch mit Lochkarten und wurden über Fernschreiber oder Textterminals bedient, und dann so etwas? Um das zu verdeutlichen: Hier ist ein Bild vom PLATO V Terminal, das sich nicht sehr vom VI unterscheidet:

PLATO V Terminal By Mtnman79 [1] [CC BY 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0) or GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)], via Wikimedia Commons
PLATO war ein Computersystem, das in den 60er Jahren an der Univerity of Illinois für die Lehre konzipiert war und tatsächlich bis Ende der 80er Jahre für Onlinekurse genutzt wurde. Es lief auf den seinerzeit schnellsten Computern der Welt und ging stets an die Grenzen des damals technisch machbaren.
Über das Buch
Das Buch beschäftigt sich aber nicht so sehr mit der Technik, sondern mit den Menschen dahinter. Es stellt und beantwortet die folgenden Fragen:
Was hat sie zur Entwicklung dieses brillianten Meilensteins der Computergeschichte motiviert und wie sind sie vorgegangen?
Wieso wollte man computerunterstützte Lehre fördern, zu einer Zeit als selbst Taschenrechner noch Science Fiction waren?
Wie konnte es geschehen, dass minderjährige Hacker die millionenteure Technik nutzen konnten, um Multiuser-Onlinespiele zu programmieren und zu spielen?
Wieso hat niemand erkannt, dass auf diesem System die Zukunft der Online Zusammenarbeit mit Chats, Mails und Foren entwickelt wurde?
Was führte nach dem technischen Höhenflug zu dem unrühmlichen Niedergang ab Mitte der 80er Jahre?
Ich habe das Buch mit Vergnügen gelesen und mir dabei Zeit gelassen. Ich habe viel gelernt – insbesondere, dass es auch schon vor über 40 Jahren “Digital Natives” gab, die sich die digitalen Werkzeuge angeeignet und abseits vom eigentlichen Einsatzzweck eigene Nutzungen und Umgangsformen entwickelt haben.
Absolut lesenswert!
In Berlin findet parallel zur Bundestagswahl auch ein Volksentscheid zum möglichen Weiterbetrieb des Flughafens Tegel (TXL) statt. Ich habe meine Stimme bereits vor über einer Woche per Briefwahl abgegeben und möchte mich jetzt mal bekennen:
Ich habe dafür gestimmt, den Flughafen Tegel weiterhin offen zu halten.
Bäng!
Bevor jetzt mit faulen Tomaten oder Eiern nach mir geworfen wird, bitte ich darum, meine Argumente anzuhören.
Ich bin nämlich eigentlich dafür, ihn zu schließen, glaube aber, dass das in der jetzigen Situation nicht richtig wäre.
Was mich an der ganzen Diskussion pro und contra Tegel stört, ist die Oberflächlichkeit der Diskussion. Wer gegen TXL ist, wohnt in der Einflugschneise und will seine Ruhe haben und wer für TXL ist, ist ein Nostalgiker, der zu faul ist, nach Schönefeld zu fahren. Meine Stimmabgabe lässt sich also ganz einfach erklären:
Ich bin halt so ein Pfeffersack, der im Prenzlauer Berg wohnt, viel fliegt und es toll findet, dass der Flughafen nicht so weit weg ist.
Das stimmt zwar – ist aber irrelevant.
Die Fahrzeit nach Tegel und nach Schönefeld (bzw dann BER) ist beinahe identisch. Vom Fluglärm bekomme ich nur dann etwas mit, wenn in Richtung Osten gestartet wird, aber dass man nicht in Ruhe am Weissensee oder in Pankow spazieren gehen kann (geschweige denn dort wohnen) finde ich auch nicht so klasse.
Worum geht es mir also dann?
Der Hintergrund meiner Entscheidung liegt ca. 25 Jahre zurück. Damals habe ich Stadt- und Regionalplanung an der TU-Berlin studiert. Kurz nach dem Fall der Mauer war in Berlin alles zusammengebrochen. Der Osten sowieso, aber auch die hoch subventionierten Betriebe im Westteil wurden geschlossen. Die Zukunft völlig offen. Welche Rolle sollte und könnte die Stadt in Zukunft spielen? Welche Anforderungen würden sich daraus ergeben? Es gab jede Menge Meinungen, die in alle möglichen Richtungen gingen, aber in zwei Punkten herrschte relative Einigkeit:
- Die Zeiten, in denen in Berlin eine nennenwerte Industrieproduktion hatte, sind endgültig vorbei
- Egal welche Rolle Berlin zukünftig spielen würde – Eine moderne und leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur wäre in jedem Fall nötig
Vor diesem Hintergrund haben wir an der TU eine Luftverkehrsplanung erstellt. Zu diesem Zeitpunkt dienten Tegel, Tempelhof und Schönefeld der Zivilluftfahrt. Die Zahlen von 1993 als Ausgangsbasis unseres Konzeptes waren:
| Flughafen |
Startbahnen |
Flugbewegungen |
Passagiere |
| Tegel (TXL) |
2 |
90.000 |
7 Mio. |
| Schönefeld (SXF) |
2 |
31.300 |
1,6 Mio |
| Tempelhof (THF) |
2 |
54.000 |
1,1 Mio |
Die Randbedingungen der Überlegungen waren weiterhin:
Keine weitere militärische Nutzung der Flughäfen. Die Russen waren bereits abgezogen, die Franzosen hatten Tegel verlassen, die Amerikaner waren gerade dabei Tempelhof Air Force Base zu räumen und der britische Militärflugplatz Gatow wurde gerade geschlossen.
Berlin würde wieder Regierungssitz werden und daher auch einen Regierungsflughafen benötigen.
Aufgrund des witschaftlichen Zusammenbruchs Berlins wurde kurzfristig nicht mit einem starken Wachstum der Verkehrszahlen gerechnet. Mittel- und langfristig wurde jedoch ein sehr hohes Verkehrswachstum prognostiziert.
Unklar war dabei der Anteil an Luftfracht, die Entwicklung der Privat- und Geschäftsfliegerei und die Frage, ob Berlin mittelfristig wieder zu einem Hub werden würde. Die Optionen sollte auf jeden Fall offen gehalten werden.
Es galt nun, die Hauptfaktoren Ausbaufähigkeit, Lärmschutz, Naturschutz, Anbindung, externe Infrastrukturkosten abzuwägen.
Zu Beginn der Planungen war zunächst alles denkbar. Die Extrempositionen waren der Weiterbetrieb aller bestehenden Flughäfen oder die Schließung aller Flughäfen und Neubau weit im Süden (Sperenberg) oder weit im Norden (Prignitz mit Transrapidanschluss von Berlin und Hamburg).
Nach sehr lebhaften, aber sachlich gut begründeten Diskussionen entschieden wir uns damals für folgende Variante:
Aus Gründen des Lärmschutzes und aufgrund von Sicherheitsbedenken sollte Tempelhof geschlossen werden.
Schönefeld sollte aufgrund seiner guten Erreichbarkeit zum einzigen Flughafen für die Verkehrsfliegerei ausgebaut werden. Um die angestrebte hohe Kapazität zu erhalten, mussten die beiden Startbahnen einen größeren Mindestabstand erhalten. Zudem lag die damalige Nordbahn zu dicht an Bohnsdorf. Unser Vorschlag war, die damalige Nordbahn zu schliessen, die Südbahn zur neuen Nordbahn zu machen und südlich davon den neuen Flughafen zu bauen und südlich davon eine neue Start- und Landebahn.
Das entspricht ziemlich genau dem späteren offiziellen Konzept des BER. So wurde er auch gebaut.
Für Tegel hatten wir vorgesehen, Verkehrsfliegerei dort nicht weiterzuführen, ihn aber als Regierungsflughafen, sowie als Standort für die Privat- und Geschäftsfliegerei weiter zu betreiben. Dadurch hätte man eine saubere Trennung von der Verkehrsfliegerei erreicht, die Kapazität in Schönefeld würde nicht durch Kleinflugzeuge beeinträchtigt, die Berliner würden erheblich weniger Fluglärm als bisher ausgesetzt sein.
Diese Überlegung finde ich auch noch immer richtig. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass der BER noch immer nicht eröffnet ist, aber bereits jetzt zu wenig Kapazität aufweist. Es geht dabei ja nicht nur um die Terminals, sondern vor allem um die Slots. Der BER hat nur zwei Startbahnen. Hierüber die normale Verkehrsfliegerei plus Regierungsfliegerei plus General Aviation abzuwickeln halte ich mittelfristig für unrealistisch.
| |
Startbahnen |
Flugbewegungen |
Passagiere |
| 1993 TXL, SXF, THF |
6 |
175.000 |
9,7 Mio |
| 2016 TXL, SXF |
3 |
282.000 |
32,9 Mio |
| Zukünftig BER |
2 |
426.000 max. |
27 Mio, 50 Mio max. |
Ein Flughafen reicht für eine Stadt, wie Berlin nicht aus. Zwei sind genau richtig.
Paris hat 3, London gar 5 Flughäfen. Oder wir bauen solche Monster wie Chicago O’Hare oder Atlanta Hartsfield, was ich aber in Deutschland für unrealistisch halte.
Das Jahr 2017 ist schon ein paar Tage alt und der 33. Chaos Communication Congress ist bereits seit einer Woche Geschichte. Mit etwas Abstand möchte ich meine Eindrücke zusammenfassen.
Entspanne und genieße
Im Gegensatz zu meinen letzten Besuchen bin ich dieses Mal etwas anders vorgegangen. Während des Kongresses habe ich so gut wie nichts veröffentlicht; Nicht auf meinem Blog und auch auf Facebook nur ein paar Bilder. Ich habe auch nicht so viele Veranstaltungen besucht, sondern mich eher entspannt treiben lassen. Der Kongress ist mit seinen 12.000 Besuchern derart groß und wuselig, dass man mit Gelassenheit viel weiter kommt, als wenn man ständig zwischen den Säälen hin und her rennt. Einige interessante Vorträge habe ich mir erst später in Ruhe zu Hause angesehen. So konnte ich in Ruhe das tolle, bunte, lustige, anregende Ambiente genießen.

33C3 Dekoration

33C3 Hackcenter

33C3 – 3D Drucker en masse

33C3 Partyzone
Traditionsgemäß waren auch diesmal wieder die ganzen Zwischengeschosse und Aufenthaltsbereiche bunt und fantasievoll dekoriert. Mal im Stil eines englischen Salons, mal sind es Beduinenzelte, dann wiederum feinstes 70er Jahre Kunststoffblasen Ambiente á la Barbarella. Die Assemblies und das Hackcenter lagen wie immer im halbdunkel, was die ganzen Spielereien mit LEDs, Projektoren und Elektrolumineszentbändern richtig zur Geltung kommen ließ. In der großen Halle war wie in den Vorjahren wieder eine clubmäßige Partyzone. Die riesigen Installationen erinnerten diesmal an Tetris und Minecraft und es wurde bereits am frühen Abend feinster chilliger Elektrobeat gespielt.

33C3 Organisation
Die Organisation ist mittlerweile unfassbar gut eingespielt. Es wurde an tausend Details gedacht, ein eigenes Telefonnetz installiert und das WLAN war immer gut. Das ist um so bemerkenswerter, weil die ganze Arbeit von Freiwilligen (Engeln) gemacht wird. In diesem Jahr hatten sich sage und schreibe 2.500 Leute dafür gemeldet – mehr als benötigt wurden.
Natürlich wimmelte es auch wieder von kleinen Späßchen: Am Eingang der Toiletten hingen Zettel, die den WLAN-Empfang mit 0-5 Sternen bewerteten, ich habe ein Wettrennen zwischen zwei Jungs auf einem rollenden grünen Cordsessel und einer Matekiste gesehen, eine Polonaise von 15 Leuten auf Hoverboards und noch viele andere lustige Sachen.
Vorsicht: CYBER!
Der Running-Gag der Veranstaltung war aber der Begriff Cyber. Ein Begriff, den seit Ende der 70er Jahre eigentlich keiner mehr benutzt, aber in letzter Zeit von Leuten, die überhaupt kein Fachwissen haben, für ihre politische Propaganda genutzt.
Folgerichtig wurde mit zwinkerndem Auge alles, was irgendwie “gefährlich” war mit gelbem Cyber-Absperrband gekennzeichnet: Von fiktiven Tatorten über Laptops, bis zu den Besuchern selber, die sich die Bänder auf ihre Klamotten geklebt haben.

33C3 – Vorsicht: Cyber!
Auch diesmal gab es natürlich wieder sehr viele spannende Vorträge mit Themen irgendwo zwischen Politik, tollen Basteleien und Raumfahrt. Einige waren lustig (wie baue ich einen Flipper selber) und einige wiederum extrem ernst (wie tötet man Menschen aus tausenden Kilometer Entfernung mit einer Drohne, wenn man nur ihre Telefonnummer hat).
Für mich waren in diesem die folgenden Schwerpunkte wichtig:
- Messenger
- Vertrauenswürdige Hardware
- Datenanalyse
Messenger
Messenger sind in den letzten Jahren ein großes Ding geworden. Ich habe so einen seltsamen Walled-Garden-Zwitter zwischen E-Mail und SMS zwar nie vermisst, aber zu meiner Verblüffung haben sich die breiten Massen auf WhatsApp und Co gestürzt und man wird mittlerweile dumm angeguckt, wenn man so etwas nicht hat. Also muss man sich wohl damit beschäftigen. Aus diversen Gründen halte ich zur Zeit keinen einzigen Messenger für gut, aber ich bin ja lernwillig. Also habe ich mir zwei Veranstaltungen angesehen.
In einem kleineren Workshop Raum fanden sich ca. 100 Zuhörer ein, um einen Vergleich der folgenden Messenger zu hören: WhatsApp, Signal, Viber, Threema, Wire, Kontalk, Facebook Messenger, Telegram, Allo und Skype. Alleine die Vielfalt zeigt schon ein Grundproblem aller Angebote: Sie sind abgeschottet. Keiner kann mit dem anderen kommunizieren, wenn der ein anderes System nutzt.
In dem Vortrag ging es nur um einen kleinen, aber wichtigen Teilaspekt: Die Sicherheit. Der Laie hört nur “WhatsApp ist ja verschlüsselt” und damit ist alles gut. Leider ist die Realität nicht so einfach. Um es kurz zu machen:
Es gab keine Lösung, die als wirklich sicher und vertrauenswürdig einzustufen ist. Skype ist bereits in der Vorrunde mangels End-to-end Verschlüsselung ausgeschieden, Threema konnte sich als “vermutlich sicher, aber nicht völlig vertrauenwürdig” noch relativ gut behaupten.
Threema war auch Untersuchungsgegenstand der Vortrags “A look into the Mobile Messaging Black Box” von Rolan Schilling, der hier zu sehen ist:
Hier wurde der Threema Messenger per reverse-Engeneering untersucht: Die Verschlüsselung selber, das Schlüssel Management und das Kommunikationsprotokoll. Das Fazit ist, dass alles handwerklich sauber zu sein scheint. Das letzte bestehende Problem ist die Vertrauenswürdigkeit des Programms selber. Die Vortragenden ermutigen Threema deshalb, den Source Code des Clients als Open Source freizugeben. Dazu haben sie bereits selber Code auf Github eingestellt, den sie qualitativ als “lediglich akademisch” eingestuft haben: https://github.com/o3ma
Vertrauenswürdige Hardware
Eine der größten momentanen Herausforderung betreffs der Sicherheit ist aktuell aber, dass es prinzipiell unmöglich ist, sicher über eine Hardware zu kommunizieren, die auf unterster Ebene von Backdoors verseucht ist. Das gilt zur Zeit für alle PC, Router, Smartphones und sonstige Geräte.
Der Vortrag “Virtual Secure Boot” von Gerd Hoffmann zielte darauf ab, wie man einen PC sicher bootet. Das ist erstaunlicherweise mit sehr viel Aufwand verbunden und kann nur bei sehr wenigen Modellen nachgerüstet werden.
Der Vortrag “Untrusting the CPU” von Jaseg handelte davon, wie auf einem nicht vertrauenswürdigen Computer sicher und verschlüsselt kommuniziert werden könnte. Der Vorschlag ist im Prinzip ein Gerät, das zwischen die Ein- und Ausgabe gehängt wird. Der Computer bekäme von den verschlüsselten Nachrichten gar nichts mit.
Der Ansatz ist auf technischem Level sehr interessant, aber auf einer höheren Ebene ziemlich am Thema vorbei. Denn die eigentliche Frage ist:
“Wie stelle ich sicher, dass ich einen Rechner ohne Backdoors habe?”
Das kann mit den Standardcomputern, die heutzutage erhältlich sind prinzipiell nicht erreicht werden. Wenn man schon so ein technisch aufwendiges Zwischengerät, wie Jaseg es vorschlägt, herstellen würde – wieso baut man dann nicht stattdessen einen einfachen und sicheren Computer?
Komplexität nicht durch noch komplexere Ansätze ersetzen
Mir ist in letzter Zeit ohnehin aufgefallen, dass es generell eine Neigung gibt, Dinge die aufgrund übergroßer Komplexität unsicher oder unbedienbar werden, durch das Hinzufügen weiterer Elemente zu reparieren. Leider wird das zugrunde liegende Problem dadurch nicht gelöst und die Komplexität steigt weiter.
Als sinnvoller empfinde ich es, eine Sicherheitslücke mit einfachen Mitteln anzugehen. In ihrem Vortrag “Hochsicherheits-Generalschlüssel Marke Eigenbau” erläutern Michael Weiner und RFGuy über eine Dreiviertelstunde lang, wie sie sich für ein bestimmtes mechanisches Schließsystem einen Generalschlüssel berechnet und angefertigt haben.
Verblüffenderweise weisen sie am Schluss darauf hin, dass das System gut sei, obwohl sie es knacken konnten. Man müsse nur aufpassen, dass die Schlüssel nicht fotografiert werden können und empfehlen daher, die Schlüssel stets in einem Mäppchen zu transportieren.
Datenanalyse
Der Satz “Ich habe doch nichts zu verbergen” zeugte schon immer von naiver Unwissenheit. Ich habe dann häufig geantwortet “Das kannst Du nicht beurteilen, weil Du nicht weißt wer wann was aus Deinen Daten herausliest.”
Genau hierzu gab es einen wundervollen Beitrag von David Kriesel: “SpiegelMining – Reverse Engineering von Spiegel-Online”, in dem eine Datenanalyse der Veröffentlichungen von Spiegel Online vorgestellt wird. Interessant sind hier bei die Erkenntnisse, die quasi “um die Ecke” gewonnen wurden. Das sind Dinge, die in den Rohdaten eigentlich gar nicht drinstecken, wie Inhaltepräferenzen der Leser, Kommentartätigkeiten, verändertes gesellschaftliches Bewusstsein und eine Abschätzung, welche Redakteure miteinander ein Verhältnis haben könnten. Absolut sehenswert!
Noch beklemmender, weil es jeden von uns angeht, ist die Datenanalyse im Vortrag “Build your own NSA” von SVeckert und Andreas Dewes auf der Basis von Webtracking. Aus einem Datensample konnten Personen de-anonymisiert werden. Als die Politikerin Valerie Wilms (MdB, Die Grünen) über die Erkenntnisse zu ihrem Tagesablauf, den Bankverbindungen, Interessen und zur Struktur ihrer Einkommensteuererklärung informiert wurde, meinte sie “Is echt alles zu sehen, ne? Scheisse!”
Fazit
Auch der 33. Chaos Communication Congress hat wieder eine Gefühlsmischung aus Neugier, Ratlosigkeit und Niedergeschlagenheit – aber auch Faszination und einer Menge Spass bei mir hinterlassen. Es war auf jeden Fall eine großartige Veranstaltung.
In diesem Jahr muss sich der CCC jedoch nach einem anderen Veranstaltungsort umsehen, da das Congress Centrum Hamburg saniert und 2019 wiedereröffnet werden soll.
Tickets für einen Hackerkongress kauft man nicht einfach – die muss man sich erarbeiten.
In diesem Jahr möchte ich gerne wieder den Chaos Communication Congress besuchen. Es ist der 33. Kongress, den der Chaos Computer Club seit 1984 veranstaltet. Aus einem gemütlichen Treff von eine paar Nerds ist ein Monster von zuletzt 10.000 Besuchern und Teilnehmern geworden. Weil der Andrang so groß ist, werden die Tickets in diesem Jahr in drei Tranchen verkauft. Die erste wurde am Montag, den 07.11. ab 20:00 verkauft. Weitere Termine sind Sa, 19.11. 15:00 und Fr, 25.11.2016.
Wie zu erwarten war der Andrang groß. So groß, dass die Server schon um 19:55 in die Knie gingen. Der Kauf der Karten hätte eine Sache von dreieinhalb Minuten sein können: Seite aufrufen, Karten in den Warenkorb legen, persönliche Angaben machen, bestätigen, E-Mail Bestätigung mit Referenznummer bekommen.
Das Positive vorneweg: Ich habe es geschafft.
Allerdings hat der ganze Prozess satte 42(!) Minuten gedauert. Zwischendurch habe ich geflucht, dass der Server permanent in die Knie ging und mit Fehlern um sich geworfen hat. Ich dachte: “Hacker sein wollen, aber nicht mal einen Onlineshop Spitzenlastfähig hinbekommen?”
Aber ich lag falsch.
Das ganze war offensichtlich ein Test, ob man auch einer Eintrittkarte würdig ist. Der Ticketshop als raffiniertes Auswahlverfahren. Man hat die Bestellung nämlich nur geschafft, wenn man sich ein bisschen in Webprogrammierung auskennt.
- Zunächst darf man sich nicht von Ladezeiten im Minutenbereich abschrecken lassen
- Vier von 5 Aufrufen endeten in verschiedenen Gateway Errors, 500 Internal Server Errors oder schlicht im Timeout.
- Man sah auch nur das HTML Grundgerüst, weil Stylesheets und Grafiken gar nicht erst nachgeladen wurden. Davon durfte man sich nicht verwirren lassen.
- Als ich nach 29 Minuten endlich soweit war, den Button “Place binding order” anzuklicken, passierte… nichts!
- Grund dafür war ein Javascript Fehler: “ReferenceError: django is not defined”. Um das zu bemerken, musste man schon mal die Entwicklerwerkzeuge des Browsers benutzen.
- Also schnell noch das Network Profiling anwerfen und die Seite neu laden. Siehe da: Alles wird brav geladen, nur der Request zu /jsi18n/en/ bricht jedesmal mit einerm Code 504 ab.
- Ich schaue mir daraufhin den HTML Code an und stelle fest, dass es sich freundlicherweise um ein normales Webformular handelt und nicht um ein eventgetriebenes Javascript-Ajax-was-weiss-ich-Gedöns handelt. Ich vermute, dass nur ein Event zur Eingabeprüfung auf dem Formular liegt. Javascript abzuschalten sollte reichen.
- Stelle fest, dass man Javascript in Firefox gar nicht mehr offiziell abschalten kann. Das geht nur noch über die Spezial-URL about:config, wenn man weiss dass der gesuchte Key javascript.enabled auf false gesetzt werden muss.
- Danach hat der Button wunderbar funktioniert.
Jetzt habe ich Tickets – ich bin würdig teilzunehmen!
Der Aufstieg der politischen Rechten in vielen westlichen Ländern irritiert und erschreckt. Ich versuche mal auch etwas Positives darin zu sehen: Es wird damit begonnen, über den Status Quo in Gesellschaft und Wirtschaft nachzudenken. Ich meine wirklich nachzudenken. Ich habe jahrelang nicht so viele Analysen und hinterfragende Artikel gelesen, wie im letzten Jahr. Es keimt ein Verständnis für “die Anderen”. Dabei meine ich keinesfalls Rechtsruck oder Anbiederei, sondern wirklich ein Hinterfragen der eigenen Standpunkte, Sichtweisen und Werte. Das ist nämlich höchste Zeit. Mich selber will ich überhaupt nicht ausnehmen.
Parallelgesellschaften
Für mich selbst war der erste Schritt zum Verständnis der Unruhe das Erkennen von Parallelgesellschaften. Dabei meine ich nicht etwa Ali und Fatima, die nach südostanatolischen Riten in Kreuzberg wohnen. Sicher – die gibt es auch, aber ich meine Parallelgesellschaften, die mich selber viel unmittelbarer betreffen.
Ich hatte vor ein paar Jahren, als ich Freunde in San Francisco besuchte, drei echte Aha-Erlebnisse die ich aber damals noch nicht recht einordnen konnte:
- Auf einer privaten Party in Berkeley wurde ich beim Smalltalk gefragt, in welchem Bereich ich in Deutschland denn so arbeite – CleanTech oder Medien. Wow – von 1000 möglichen Berufsfeldern kamen offensichtlich nur zwei in Frage – und eins war tatsächlich ein Treffer!
- Als ich durch die Cafés im Mission District in San Francisco schlenderte, fiel mir etwas auf; Die Leute um mich herum waren mir angenehm, ich verstand die Dresscodes, hatte eine Idee, wie und an was sie arbeiten und wie sie ticken. Ich kam mir nicht als Tourist und Ausländer vor. Obwohl ich mir sehr klar darüber bin, dass in den USA sehr viele Dinge erheblich anders laufen, als in Deutschland, fühlte ich mich fast wie zu Hause. Ich hatte das Gefühl, mit diesen Leuten mehr Gemeinsamkeiten zu haben, als mit vielen Deutschen aus der Provinz. Gleichzeitig war mir klar, dass dieser Ort zwar geographisch in den USA lag, aber mit Werten, Normen, Zielen und Verdienstmöglichkeiten der amerikanischen Durchschnittsbevölkerung überhaupt nichts zu tun hat.
- Auf einer Firmenparty in Downtown San Francisco kam ich mit Softwareentwicklern aus USA, Schottland und Serbien locker ins Gespräch. Irgendwann sprachen wir über die Verständlichkeit der verschiedenen englischen Dialekte, weil die Leute dort aus allen Teilen der Welt zusammenarbeiten. Ich sagte irgendwann, dass ich eigentlich alle so einigermaßen verstehe – nur bei der Autovermietung hätte ich drei mal nachfragen müssen. Darauf wurde locker eingeworfen “ja, aber das waren sicherlich Schwarze”. Darauf meinte ich, dass die Aussage nicht gerade politisch korrekt wäre. Die Antwort saß wie die Faust im Gesicht: “Das stimmt – aber sei ehrlich: Wie viele Schwarze hast Du heute auf der Konferenz gesehen, oder in den Firmen die Du besucht hast? Da sind weiße Amerikaner aus der Mittelschicht, Europäer, Asiaten und ein paar Inder. Alle alle haben studiert. Es gibt so gut wie keine Mexikaner, keine Schwarzen, keinen White Trash”.
Ein weiteres Aha-Erlebnis hatte ich neulich in Berlin. Ich hatte eine Foto-Session, bei der ich systematisch den Bereich um die Marzahner Promenade fotografiert habe.
Marzahn – jener Stadtteil, von dem man in Prenzlauer Berg schon mal abschätzig sagt, dass er “kurz vor Polen liegt” und das nicht nur geographisch, sondern auch wirtschaftlich meint. Man weiß ja, wie es dahinten zugeht: Platte, Ghetto, Wendeverlierer und Rechtsradikale, no-go Area. Nicht wahr – das weiß man doch.
Quatsch! Gefühltes Wissen. Eigentlich weiß man gar nichts, weil man nie dort ist und auch niemanden kennt, der dort wohnt. Was habe ich also vorgefunden?
- Zunächst mal sehr viel Platz. Breite Straßen, ziemlich viel Grün. Sehr großzügige Fußgängerbereiche zwischen den zehngeschossigen Plattenbauten. Das ist schon mal sehr viel anders, als im Berliner Innenbereich, wo jede Baulücke geschlossen wurde, die Parks totgefeiert werden und die Verkehrs- und Agressionsdichte sehr hoch ist.
- Ich habe viel mehr Ausländer gesehen, als ich erwartet hatte. Da hat sich in den letzten Jahren offensichtlich einiges geändert. Die Anzahl der Menschen, die offensichtlich von sehr wenig Geld leben müssen, kam mir auch sehr hoch vor.
- Interessant, aber auch, was ich NICHT vorgefunden habe: Penner, Graffitis, Scherben auf den Fußwegen und ramponierte Grünanlagen. Man spürt die Bemühungen, den Ort in Ordnung zu halten. Die Gebäude sind saniert, die Wege sauber, die Marzahner Promenade wird neu gestaltet.
- Marzahn ist von Prenzlauer Berg gerade mal 10 Km entfernt, und trotzdem war ich von dem Ort überrascht. Dort wohnen viele Menschen, die sich die Innenstadt nicht mehr leisten können. Weniger Geld bedeutet aber eben nicht zwangsweise Ghetto.
Stammeszugehörigkeit statt Nationalität
Ich fragte mich, wie es sein kann, dass ich mich einem 9000 Km entfernten Stadtteil einer US Großstadt emotional näher fühle, als einem 10 Km entfernten Ortsteil meiner eigenen Stadt?
In Marzahn fiel mir spontan der Begriff “Parallelgesellschaft” ein. Und mir wurde klar, dass die Parallelgesellschaft nicht in Marzahn wohnt, sondern in Prenzlauer Berg.
Ich bin selbst die Parallelgesellschaft.
Und plötzlich machen viele Dinge Sinn, über die ich mich stets etwas gewundert hatte:
Damals in San Francisco hatte ich das vage Gefühl, einem geheimen Stamm anzugehören, der sich kaum über die geographische und kulturelle Herkunft definiert, sondern sich sein Wertesystem gerade selber zusammenbastelt. Mir fiel der alte Spontispruch ein, dass die wahren Grenzen nicht zwischen den Völkern verlaufen, sondern zwischen oben und unten. Aber ich war weder oben noch unten, sondern irgendwie parallel daneben.
Ich war verblüfft, wieviele Menschen in Europa nicht nur den Euro abschaffen, sondern auch wieder Grenzkontrollen einführen wollen. Sicherlich ist vieles in der EU reformbedürftig, aber genau die Reise- und Niederlassungsfreiheit und die gemeinsame Währung habe ich immer als einen der wichtigsten Erfolge der 90er Jahre gesehen. Es war mir völlig unverständlich, wie man dagegen sein kann.
Ganz klar: Wir haben völlig unterschiedliche Perspektiven.
Ich habe selber schon mal ein paar Monate im Ausland gearbeitet, war immer mobil. Ging ja nicht anders, wenn man einen halbwegs vernünftigen Job haben wollte. In meinem Freundes- und Bekanntenkreis sieht es nicht viel anders aus: Drei Personen sind in den letzten Jahren nach Australien ausgewandert, einer nach Argentinien, drei nach Kalifornien. Eine Bekannte hat drei Jahre in Saudi-Arabien gearbeitet, bevor sie in die Schweiz gezogen ist und eine Person hat bereits in Marseille und Rio de Janeiro gewohnt, bevor sie nach Deutschland zurück kam.
Das hängt natürlich auch vom Beruf ab. IT, Medien, Management, Kunst,…
Ich habe Bekannte, die in Nordfinnland wohnen. Ab und an trifft man sich mal in Berlin oder eben dort oben. Das ist für mich so normal, dass ich gar nicht mehr darüber nachgedacht habe.
Aus meiner Perspektive ist jede Grenze und alles was meine Mobilität behindert schlecht.
Kontrollverlust und fremde Werte
Die breite Masse mit normalen Jobs (Verkäufer, KFZ-Mechaniker, Friseur, Verwaltungsangestellte, …) ist bei weitem nicht so mobil. Die fliegen vielleicht einmal im Jahr für zwei Wochen nach Mallorca, falls sie es sich leisten können.
Deren Perspektive ist nicht, dass sie selber mobil sein wollen, sondern dass von überall her Leute kommen, die sie nicht eingeladen haben. Gleichzeitig sind immer mehr Arbeitsplätze ins Ausland verlagert worden. Die Menschen sind damit einfach überfordert und fühlen sich überrollt.
- Sie protestieren dagegen, dass normale Arbeit vollkommen entwertet wurde.
- Sie protestieren dagegen, dass ihre Werte nicht mehr respektiert werden.
- Sie protestieren dagegen, dass ihnen auf arrogante Art ständig andere Werte aufgezwungen werden sollen: Flexibilität statt Sicherheit, Weltoffenheit statt Bodenständigkeit, veganes Essen statt leckerem Schweinebraten, Radfahren statt einem schicken Auto, Urbanität statt Häuschen im Grünen, usw.
- Sie protestieren eigentlich nicht gegen die offenen Grenzen, sondern gegen den eigenen Kontrollverlust.
Und das kann ich sehr gut verstehen.
Und unsere Führungskräfte müssen das auch verstehen – und zwar ziemlich schnell. Wir brauchen bedachte Kurskorrekturen, bevor die Gegenbewegung eine Dynamik annimmt, die mehr kaputt macht, als wir und vorzustellen wagen. Das gilt für Deutschland genauso, wie für die USA, Großbritannien, Frankreich und eigentlich alle westlichen Länder.
Ich möchte hier noch auf einen Artikel im Tagesspiegel verweisen, der ähnlich argumentiert: “Eine andere Welt ist möglich – aber als Drohung“
Damals in der 80ern waren nicht nur die Heimcomputer neu, sondern auch diverse Zukunftsszenarien aus damals aktuellen Science-Fiction Geschichten. Ganz heiß erschien damals die Idee vom Cyberspace, oft auch Virtual Reality (VR) genannt. Eine völlig künstliche Umgebung, die nicht den Zwängen der realen, körperlichen Welt unterlag. Eine konstruierte Welt aus Software, in der man sich scheinbar grenzenlos bewegen konnte. Unendliche Möglichkeiten schienen sich aufzutun…
Die ersten wirklichen Versuche, VR umzusetzen waren in den 90ern dagegen ziemlich ernüchternd. Und zwar so sehr, dass das Thema – bis auf Nischenanwendungen, wie Automobildesign – eigentlich seit 20 Jahren vom Tisch ist.
In den letzten 1-2 Jahren kocht das Thema aber so langsam wieder hoch. Ich muss zugeben, daß mich das ziemlich kalt lässt. Als Jugendlicher wäre ich damals vermutlich völlig drauf abgefahren, aber mir ist die Idee mittlerweile einfach zu abgedroschen.
Trotzdem kann natürlich ein kleiner Reality-Check nicht schaden. Versuchen wir mal die Einsteigerdroge: Google Cardboard.
Let’s do it!
Ich hatte mir vor drei oder vier Monaten schon mal Google Cardboard auf meinem Smartphone installiert, aber ohne VR-Brillengestell machte das keinen Sinn. Also hatte ich die App erstmal wieder gelöscht. Am Samstag bin ich bei Conrad über einen Stapel VR-Brillen von Google gestolpert. Kostet ja nicht sooo viel, also habe ich eine der Pappschachteln mitgenommen.

Google Cardboard

Fertig zum Aufsetzen
Das Prinzip ist simpel: Eine Pappschachtel mit zwei Linsen, in die man sein Smartphone klemmt, das ganze auf die Nase setzt und mit den Halteriemchen am Kopf fixiert.
Aber vorher musste ich die App neu installieren, weil ich sie ja zwischenzeitlich gelöscht hatte und – oh Wunder – mein Telefon ist plötzlich nicht mehr kompatibel. Wieso? Vor drei Monaten ging es doch. Ich habe Android 6 auf dem Phone – von veraltet kann also keine Rede sein. Nun gut, also habe ich mit ein paar andere VR-Apps heruntergeladen und damit etwas rumgespielt.
Fazit
Die Erfahrung kann ich in einem Wort zusammenfassen:
Schrott!
Oder etwas ausführlicher:
- Man sieht wie der letzte Mutant aus. Smombies sind ein Scheissdreck dagegen.
- Die Kiste mit dem Smartphone auf der Nase nervt – es ist zu schwer und stört einfach nur.
- Die Fokussierung stellt sich auch nicht gerade von selbst ein. Ich musste mich ziemlich konzentrieren.
- Keine der Apps hat den Gyroskop im Telefon richtig benutzt. ein Kopfschwenk führte meistens zu gar nichts oder zu einer verzögerten Bewegung, die überhaupt nicht synchron zur Körperbewegung.
- Die Bedienung ist problematisch, weil man den Touchscreen ja nicht mehr anfassen kann.
- Dadurch, dass man mit den Augen direkt am Display ist, wirkt das Bild ist unglaublich grobkörnig. Ohne 4K-Display braucht man so etwas gar nicht anzufangen.
- Von dem Fake-3D wird mir innerhalb von 30 Sekunden übel.
- Es gab keine einzige App, die mich inhaltlich irgendwie interessiert hätte.
Gut, einige der Punkte davon könnte man mit richtiger Hard- und Software korrigieren. Aber eine wesentlich teurere Kombination aus High-End Samsung Phone und der dazugehörigen Brille war auch nicht viel besser.
Meiner Meinung nach ist die ganze VR-Idee – von einigen Spezialanwendungen wie Konstruktion oder Simulatoren mal abgesehen – für die breite Masse unsinnig.
Und überhaupt…
Daß so beharrlich versucht wird, diese eigentlich schon begrabene Idee wieder aufzuwärmen, hinterlässt bei mir einen faden Beigeschmack. Virtual Reality reiht sich für mich in eine täglich länger werdende List von technischem Zeug, dass ich explizit nicht haben will, wie z.B.:
Internetfähiger Kühlschrank. Die Idee war vor 20 Jahren Schrott, vor 10 Jahren Schrott, ist immer noch Schrott und bleibt es auch.
Chatbots. Noch so ein 20 Jahre alter aufgewärmter Quark. Was soll toll daran sein, mit begriffsstutzigen Maschinen zu reden? Das nervt ja bei Menschen schon genug.
Smarthomes und überhaupt alles, was gerade mit “Smart-” anfängt. Damit absolut jeder Lebensbereich ausgeforscht und im nächsten Schritt ferngesteuert werden kann. Und wir entwickeln uns alle im Rekordtempo zurück zu Amöben. Einige sind ja schon recht weit auf diesem Weg…
Internet of Things. Super, dass jetzt nicht nur mein Computer und mein Handy, sondern auch Lampen, Stereoanlagen, Heizungen, Blumenvasen und Bilderrahmen tägliche Securityupdates brauchen – und trotzdem gehackt werden. Das steigert so richtig die Lebensqualität.
Selbstfahrende Autos. Woher kommt diese Scheiß Idee eigentlich plötzlich? Ich habe in den letzten Jahren eigentlich niemanden gehört, der der Meinung ist, das größte Problem an Autos sei, dass man sie selber fahren muss. Eher so Umwelt, Platzverbrauch, Lärm, Zersiedlung der Landschaft, Ressourcen und ähnliche Dinge.
Eigentlich kann es doch nur darum gehen, so langsam wieder von den Autos wegzukommen und die restlichen mit erneuerbaren Energien anzutreiben.
Mobile Payment. Wenn mir das Handy geklaut wird, ist also nicht nur mein Telefon weg, meine Kontaktdaten, mein Kalender, meine Fotos, meine Social Media Zugänge kompromittiert, sondern auch noch das Geld, was ich auf dem Konto habe. Im Alltag bleibt das Standardproblem jeder bargeldlosen Finanztransaktion: die völlige Nachverfolgbarkeit jeder kleinen Zahlung. Ist ja ‘ne Super Idee – ich bleibe bei Bargeld.
Künstliche Intelligenz. Seien wir doch mal ehrlich: Das werden alles absolut unerträgliche digitale Klugscheißer werden, die uns das Leben auf jede erdenkliche Art zur Hölle machen. Ist ja selten genug, dass man überhaupt mal natürliche Intelligenz endeckt.
Ich habe das Gefühl, dass diese dämlichen und ausgelutschten Ideen alle paar Jahre wieder rausgeholt werden, um zu prüfen, ob das Volk jetzt endlich verblödet und degeneriert genug ist um vollständig entmündigt zu werden. In anderen Gegenden der Welt wird dafür Religion verwendet und bei uns läuft es halt so.
Früher hat man seine Schallplatten auf Compact Cassetten aufgenommen um die Musik auch unterwegs auf dem Walkman hören zu können. Heute ist alles als MP3 auf dem Handy gespeichert. Ich finde es immer noch verblüffend, wenn die Musik, die früher mindestens ein ganzes Regal gefüllt hätte auf einer Micro SD Karte passt, die kleiner als ein Daumennagel ist.
Aber irgendwas ist ja immer. Wenn die MP3 Sammlung ein bisschen größer wird, nerven falsche Tags kolossal. Klassiker sind notorisch falsch gepflegte Erscheinungsjahre, unterschiedliche Schreibweisen von Interpreten die daher mehrfach in den Auflistungen der Player angezeigt werden und ähnliches.
In letzter Zeit habe ich einige meiner alten Vinylplatten mit Audacity digitalisiert. Beim Speichern als MP3 Datei habe ich natürlich die wichtigsten Angaben Interpret, Titel, Erscheinungsjahr, Tracknummer usw. gepflegt. Das dauert alles so seine Zeit, aber man möchte ja ordentlich sein.
Nachdem ich die Songs auf meinem Handy hatte, wollte Google Play davon aber leider nichts wissen. Alle sechs Alben wurden unter “Unbekannter Interpret” aufgelistet. Wie lästig!
Nach etwas Recherche wurde deutlich, dass Google Play ziemlich zickig mit den MP3 Tags ist.
Was nun?
Es gibt diverse Software, mit der MP3 Tags nachbearbeitet werden können. Ich habe MusicBrainz Picard genutzt, dass eine Art Autovervollständigung hat. Nachdem ich die fraglichen Dateien entsprechend bearbeitet habe, erkannte nun auch Google Play die Interpreten.
Bei solchen Dingen muss ich immer daran erinnern – Computer machen das Leben einfacher :-D
« Previous Page — Next Page »